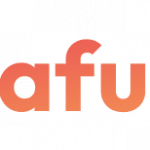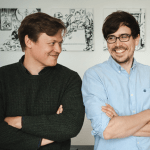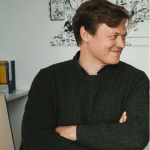Hohe Lernlast im Studium mit der Aussicht auf lange Nachtschichten, unzählige Überstunden und täglich überbordende Aktenberge, die bearbeitet werden müssen. Der Juristenberuf ist geprägt von einem extrem hohen Zeit- und Leistungsdruck. Das belastet nicht nur viele Jurastudierende, es beeinflusst sie auch maßgeblich bei der späteren Berufswahl. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Lernplattform Jurafuchs, bei der angehende Juristen zu aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen sowie zu ihren Zukunftsvorstellungen und eigenen Prinzipien befragt wurden.
Jurastudium für jeden Vierten intensiver als ein Vollzeitjob
Ein Nebenjob parallel zum Jurastudium ist für die meisten Studierenden gar nicht machbar: Jeder zweite Befragte wendet mindestens 30 Stunden pro Woche für das Studium auf. Davon lernen 16,4 Prozent sogar zwischen 40 und 50 Stunden und 5,6 Prozent mehr als 50 Stunden pro Woche. Das spiegelt sich auch im Leistungsdruck wider, mit dem knapp ein Drittel (32,2 Prozent) schlecht klarkommt. Demgegenüber kommen nur 24,6 Prozent gut bzw. sehr gut mit den Anforderungen des Studiums zurecht, 43,2 Prozent stufen den Leistungsdruck als durchschnittlich ein.
Entsprechend groß ist auch die Sorge unter den Studierenden, dass das hohe Arbeitspensum nach dem Studium nicht abnimmt: 42,8 Prozent haben im Hinblick auf die eigene berufliche Zukunft vor allem Angst vor der fehlenden Work-Life-Balance im Juristenberuf. Neben der Arbeitslast gehören auch moralische Bedenken zu den Sorgen unter den Studierenden: 38,5 Prozent nennen die Spannung zwischen Gesetz und gefühlter Gerechtigkeit als zentrale berufliche Herausforderung. Zweitrangig ist hingegen die emotionale Belastung durch bestimmte Fälle sowie der Konflikt zwischen Geld und Mandantenwohl, den 10,6 bzw. 8,2 Prozent als Herausforderung sehen.
Fast niemand möchte Pflichtverteidiger werden – Richter zweitbeliebtester Berufswunsch
Bei der Frage, in welchem Bereich die angehenden Juristen später mal arbeiten möchten, beeinflusst die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben ebenfalls die Berufswahl. Der Arbeit in einer Großkanzlei etwa, die den Ruf hat, besonders zeitintensiv zu sein, möchten nur 10,7 Prozent nachgehen. Am beliebtesten ist hingegen ein Arbeitsplatz in einer mittelständischen Kanzlei, den sich 14,8 Prozent wünschen.
Ein öffentliches Amt als Richter bzw. als Staatsanwalt möchten immerhin 14,3 bzw. 11,1 Prozent bekleiden, weitere 11,3 Prozent sehen sich perspektivisch im Staatsdienst in der Verwaltung oder in Ministerien. Damit ist das Richteramt der zweitbeliebteste Berufswunsch unter den Studierenden. Die Nachbesetzung in Deutschlands Staatsanwaltschaften und von Berufsrichtern ist besonders relevant: Bereits jetzt ziehen sich Verfahren aufgrund der langen Bearbeitungsdauer in die Länge, ein Problem, das mit dem anhaltenden Personalmangel nicht kleiner wird. Verschwindend gering ist hingegen der Anteil an Befragten, die später in der Pflichtverteidigung arbeiten möchten: Nur 2,9 Prozent können sich zukünftig die Arbeit in diesem Feld vorstellen.
Neben den gängigen Berufsfeldern können sich 6,9 Prozent der Studierenden einen Job in der Politik vorstellen. In einem Vergleich der akademischen Laufbahnen der aktuellen Bundestagsabgeordneten haben wir bereits herausgefunden, dass 150 der 630 Abgeordneten Rechtswissenschaftler sind, womit Juristen den Bundestag dominieren. Weitere 6,4 Prozent möchten später gerne in einer NGO bzw. gemeinnützigen Organisation arbeiten, 5,1 Prozent bevorzugen einen Job in der Wissenschaft. 4,9 Prozent wissen hingegen noch gar nicht, in welchem Beruf sie nach dem Studium arbeiten möchten.
Hohes Gehalt wichtiger als Gerechtigkeitssinn
Im Hinblick auf die Gründe, warum sich die Studierenden für eine Laufbahn als Jurist entschieden haben, war vor allem das fachliche Interesse an Politik und Gesellschaft ausschlaggebend (21,5 Prozent). Dahinter stehen die guten Verdienstchancen, weshalb sich 20,3 Prozent für die Arbeit im Rechtswesen entschieden haben. Erst an dritter Stelle steht der Gerechtigkeitssinn mit anteilig 18,7 Prozent. Drei Prozent haben hingegen keine klare Motivation für das Jurastudium.
Für viele, die in einer Großkanzlei arbeiten möchten, ist der Gerechtigkeitssinn (15,8 Prozent) nur nebensächlich und kommt erst nach den guten Verdienstchancen (24,7 Prozent), fachlichem Interesse (21,7 Prozent) und der beruflichen Sicherheit (16,8 Prozent). Auch bei angehenden Richtern und Staatsanwälten sagt nur jeder vierte Studierende, dass der Gerechtigkeitssinn zentrale Motivation ist (19,6 bzw. 20,2 Prozent). Zum Vergleich: Unter den Studierenden, die später in einer NGO oder in der Pflichtverteidigung arbeiten möchten, ist der Gerechtigkeitssinn für 23,4 bzw. 23,1 Prozent ausschlaggebend bei der Berufswahl.
Jeder dritte Befragte sieht keinen Mehrwert im Einsatz von KI im Rechtsbereich
Der Einsatz von KI-Modellen wird zukünftig die Arbeit im Rechtsbereich maßgeblich prägen, was die Mehrheit der Befragten als Bereicherung empfindet. 60,1 Prozent sehen das Potenzial, dass KI-Tools bei der Bearbeitung von Routineaufgaben unterstützen können. Nicht alle Studierenden denken jedoch, dass der Einsatz von KI vorteilhaft ist. 27,9 Prozent aller Befragten sind der Meinung, dass KI bei der Bearbeitung wiederkehrender Aufgaben nicht gut unterstützen kann, weitere 12 Prozent können es nicht beurteilen. Zudem machen sich 32,5 Prozent aufgrund der Entwicklung von KI Sorgen um den eigenen Job. Unter denen, die in der Nutzung von KI bei Routineaufgaben keinen Mehrwert sehen, liegt der Anteil sogar bei 70 Prozent. Das zeigt, dass die Skepsis gegenüber dem Nutzen von KI mit deutlich höheren Jobängsten einhergeht.
Jurafuchs-Gründer: KI-Tools können Lernprozess für Studierende optimieren
„Die Juristinnen und Juristen von morgen möchten nicht nur Anerkennung und Karriere, sondern auch Zeit für sich selbst. Work-Life-Balance ist längst kein Randthema mehr, sondern prägt die Berufswahl entscheidend. Das heißt aber keineswegs, dass sie weniger leisten wollen, im Gegenteil: Schon im Studium investieren Studierende teilweise mehr Wochenstunden als in einem Vollzeitjob.”, kommentiert Jurafuchs-Mitgründer Dr. Carl-Wendelin Neubert die Ergebnisse der Untersuchung. Er ergänzt:
„Vor diesem Hintergrund ist die Haltung der Studierenden zur Künstlichen Intelligenz besonders interessant: Einerseits sehen sie die Chance, Routinearbeiten abzugeben und dadurch Zeit zu gewinnen, andererseits fürchten sie, dass sie durch KI verdrängt werden.
Wie stark KI die Juristerei am Ende verändern wird, ist noch offen. Sicher ist jedoch: Sie wird sowohl die Arbeitspraxis als auch die Ausbildung prägen. Doch viele Universitäten haben hier noch erheblichen Nachholbedarf. Wir von Jurafuchs haben daher unser eigenes Legal AI-Modell ‚Foxxy’ entwickelt, das Studierende unterstützt, indem es unter anderem juristische Verständnisfragen in Echtzeit beantwortet. Unser Ziel ist es, KI frühzeitig ins Lernen zu integrieren und damit Wege aufzuzeigen, wie die juristische Ausbildung zukunftsfähig gestaltet werden kann. Digitale Kompetenzen gehören längst ins Studium, und die Hochschulen sollten diese Entwicklung nicht verschlafen.”
Über die Untersuchung
Bei der Umfrage wurden insgesamt 767 Jurastudierende über die Jurafuchs-App im Zeitraum vom 26.08.2025 bis zum 23.09.2025 in vier Blöcken zur Drucksituation im Studium, ihrer Zukunftsperspektive, dem Einfluss von KI auf Jura und ihren ideologischen Prinzipien befragt.